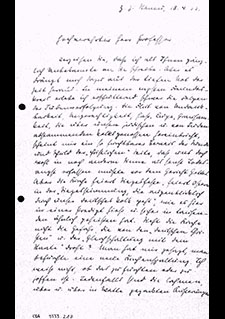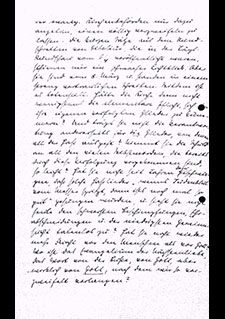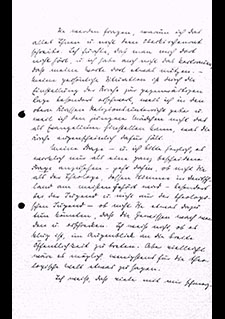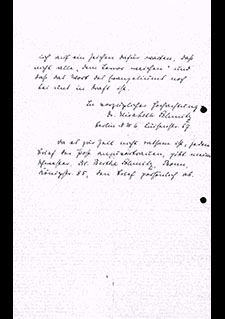Briefe an Karl Barth
Voller Mitgefühl für die diskriminierten „Nichtarier“, deren Leid sie im nächsten Umfeld erlebte, versuchte Elisabeth Schmitz seit Frühjahr 1933 ihre Kirche zu einem Zeichen der Solidarität mit den Ausgegrenzten und Verfolgten zu bewegen.
Im April 1933 wandte sie sich zum ersten Mal an den einflussreichen Theologen Karl Barth, um ihn zu einer Stellungnahme zur Judenverfolgung zu bewegen. Barth teilte zwar ihre Meinung im Hinblick auf die politische Entwicklung, wollte jedoch seine theologische Lehrtätigkeit nicht gefährden, von der er sich eine stärkere Wirkung im Sinn einer sich selbst besser verstehenden Kirche versprach, als von einem öffentlichen Votum, das vermutlich nie gedruckt werden würde.
Schmitz ließ jedoch nicht locker. Im Januar 1934 wies sie Barth erneut auf die verzweifelte Lage insbesondere der Christinnen und Christen jüdischer Abstammung hin. In ihren Briefen fand Schmitz deutliche Worte für ihre Kirche, die eine solche Entwicklung zulasse und teilweise unterstütze. Kirche und die Christen in Deutschland hätten in der einfache[n], schlichte[n], selbstverständliche[n] christliche[n] Liebe [...] rettungslos versagt.
Auch Barth war der Auffassung, dass die Kirche in dieser Sache versagt habe. Die gegenwärtige evangelische Kirche sei jedoch das, was gerade auch der kirchlich-theologische Liberalismus aus ihr gemacht habe. Zudem bat er sie, die möglichen Auswirkungen des Kirchenkampfes nicht zu gering zu schätzen.
Die Harnack-Schülerin Schmitz verteidigte hingegen den liberalen Protestantismus und verwies auf die nationalistischen, antisozialistischen und antisemitischen Tendenzen innerhalb der evangelischen Kirche. Für das entscheidende Kriterium hielt sie letztlich, ob der Einzelne zuerst Gott oder zuerst dem Staat gehorsam ist.
Als Sofortprogramm forderte sie von der Bekennenden Kirche, dass die Mitglieder des Pfarrernotbundes sich um ihre verfolgten Gemeindemitglieder kümmerten. Die evangelischen Gemeinden sollten Kontakte zu jüdischen Gemeinden pflegen. In Predigt und Unterricht müsste die christliche Liebe ganz stark betont werden. Sie selbst versuchte, dies in ihrem Religionsunterricht zu tun.
Zwischen 1936 und 1939 besuchte Elisabeth Schmitz in jedem Sommer Karl Barth in der Schweiz. Die Gespräche mit ihm über theologische und kirchenpolitische Fragen waren für sie helle Lichtblicke in diesen finstern Jahren (Brief an Barth vom 4. Juni 1946).
Quelle / Titel
- © Karl Barth-Archiv, Basel